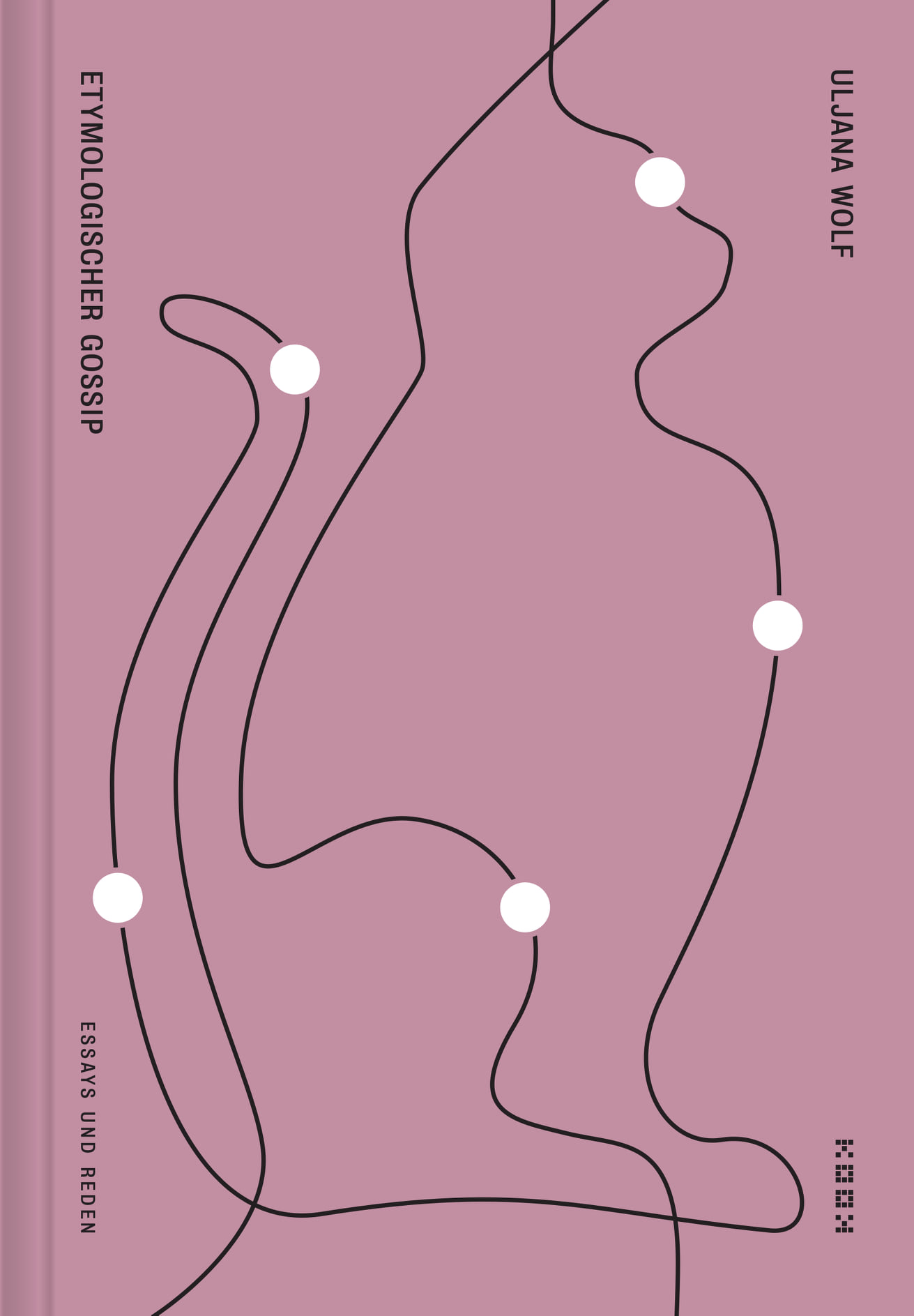In der literarischen Wunderkammer: Ein neuer Band mit Essays und Reden von Uljana Wolf versammelt poetologische Selbstauskünfte, dokumentiert produktive Auseinandersetzung mit Kolleginnen und Kollegen – und ist ein Wegweiser durch ihr bisheriges Gesamtwerk.

Im Mittelpunkt steht dabei die für wohl keine andere Dichterin ihrer Generation so charakteristische Beschäftigung mit Sprache, sei es dem Polnischen, das ihren Debütband Kochanie, ich habe Brot gekauft prägte, dem Englischen der false friends und eigener Übersetzungen als Ausgangs- und Zielsprache, aber auch dem Belarussischen (etwa bei Valzhyna Mort). Von Uljana Wolfs Übersetzungen aus dem Englischen, insbesondere der Texte von Christian Hawkey und Matthea Harvey, handelt der erste Teil von Etymologischer Gossip, das jetzt bei Kookbooks erschienen ist; der Gegenrichtung widmet sich der zweite Teil, der überraschende Einblicke in das Werk von Christine Lavant gibt, aber auch die große Faszination Wolfs für das Werk von Ilse Aichinger zeigt. Besonders faszinierend: Die der Textart nach Dankesreden, Nachworte, Zeitschriftenbeiträge, die das Buch ausmacht, reihen sich zum Teil so nahtlos aneinander und greifen gegenseitig ihre Motive auf, dass es ein Genuss ist, einfach weiterzulesen. Ebenso erschließt sich das dichterische Werk Uljana Wolfs ganz nebenbei; von großer Empathie geprägt sind wiederum die Beiträge im letzten Teil des Bandes, die sich Dichterkolleginnen wie Dagmara Kraus, LaTasha N. Nevada Diggs, M. NourbeSe Philip, Theresa Hak Kyung Cha und ihren jeweils auf eigene Weise außergewöhnlichen Werken widmen.
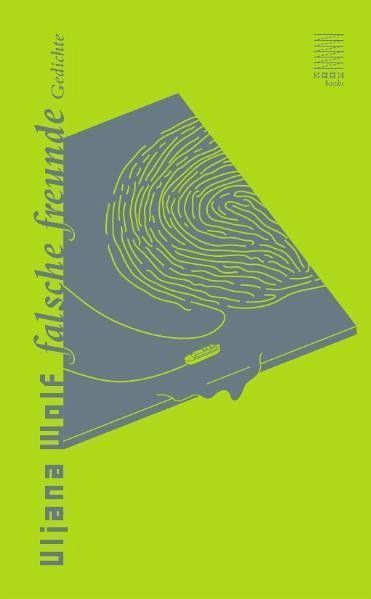
Ein weiterer Genuss bei der Lektüre von Uljana Wolfs Texten ist ihr Umgang mit der Sprache selbst, beispielhaft in diesem magisch aufgeladenen Auftakt eines Essays über das Übersetzen von Ilse Aichinger: „Schnee habe ich in Rom nur einmal gesehen. Er deckte einen Morgen lang sämtliche Risse und Schlaglöcher zu. Als er geschmolzen war, hatten sich die Risse und Schlaglöcher unter seiner weißen Inkubationshaube vermehrt, als gäbe es eine negative Brutlogik, die irgendwo am kalten, schartigen Sprachrand der Wirklichkeit Brut an Brutalität koppelt und Schnee an die Möglichkeiten der Nichtexistenz.“ Es erfüllt mit Glück, Uljana Wolfs Gedankenbewegungen zu folgen, wenn sie die Strategien ihrer Übersetzungsarbeit beschreibt. Gleichsam überraschend sind die vielen kleinen Geschichten, die in den Essays stecken: Sei es über die Mutter des Monkeys-Sängers Michael Nesmith, die das Liquid Paper, eine Art Tipp-Ex, erfindet und dabei eine direkte Linie zu Uljana Wolfs und Christian Hawkeys Erasure-Gedichten Sonne From Ort bildet; oder über den Physiker John Scurlock, der 1957 versehentlich die Hüpfburg erfunden hat, aus deren unvorhersehbarem Inneren, in dem ihre „Passagiere“ ungeordnet durch den Raum fliegen, sich eine Art Ursymbol für die Poesie bildet. Einen von mehreren roten Fäden bildet Walter Benjamins Kindheit um neunzehnhundert, insbesondere die Miniatur „Mummerehlen“, aus der das einprägsam-schöne Zitat von den „Worten, die Wolken waren“, stammt – sie ist unter anderem autobiografischer Anknüpfungspunkt von einer Fahrt mit der Seilbahn auf dem Gelände der Gärten der Welt in Berlin-Kaulsdorf, wo Uljana Wolf aufwuchs: Hier befindet sich auf dem 102,2 m hohen Kienberg die Aussichtsplattform „Wolke“.
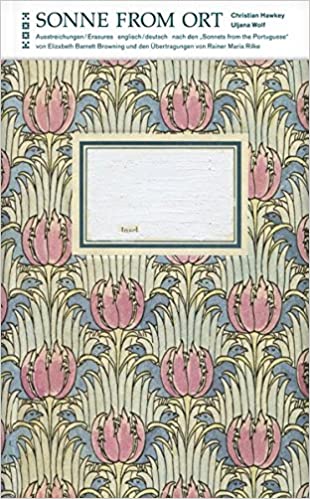
Eine besondere Stellung in Etymologisches Gossip nimmt ein Gespräch zwischen Uljana Wolf und dem norwegischen Dichter Simen Hagerup unter dem Titel „Fibel Minds“ ein, das die beiden anlässlich des Audiatur-Festivals in Bergen per E-Mail geführt haben: Es wirft noch einmal mehr als die auch in den übrigen Texten gelegten autobiografischen Spuren einen Blick hinter die Kulissen, der Wurzeln und Einflüsse deutlich macht, die das Besondere von Uljana Wolfs Dichtung insgesamt ausmachen: Der Austausch mit Dichterkolleg*innen über Ländergrenzen hinweg, das Beschäftigen mit Konzepten der hybriden Dichtung, und dabei doch immer wieder das Festhalten an der deutschen Sprache, die sie kreativ und schöpferisch immer wieder neu aktualisiert.
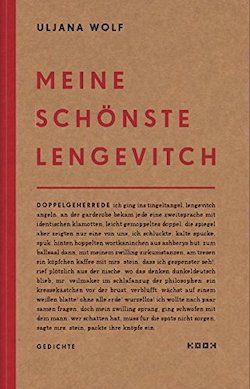
Am Beispiel von Dagmara Kraus, der sich gegen Ende des Bandes gleich zwei Beiträge widmen, zeigt Uljana Wolf noch einmal ganz konkret, wie dieser kreative Umgang mit Sprache aussehen kann: Die zwischen allen Stühlen stehende Kunstsprache, der sich die in Polen geborene, nun in Deutschland und Frankreich lebende Dichterin bedient, folgt nach ihrer Argumentation eine Strategie der „Minorisierung“ der deutschen Hegemonialsprache, die in Vermischung mit polnischen, englischen und französischen Versatzstücken gewissermaßen lustvoll vom Thron gestoßen wird.
Mit seinen über 200 Seiten bietet Etymologischer Gossip eine ausführliche, beeindruckende Bilanz von Uljana Wolfs bisherigem Schaffen, die durchweg fasziniert. Wo sie die Hüpfburg wohl als nächstes aufschlägt?
Uljana Wolf: Etymologischer Gossip. Essays und Reden, Kookbooks, 232 Seiten, 22 €
Die Gestaltung aller im Beitrag gezeigten Bände, auf die hier bereits gesondert eingegangen wurde, stammt von Andreas Töpfer.